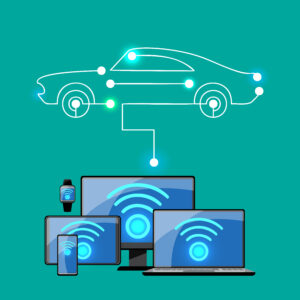Ladeinfrastruktur (LI) ist der Oberbegriff für Ladepunkte und Ladesysteme inkl. der Verwaltungswerkzeuge für den Betrieb, die zum Laden von Elektrofahrzeugen zur Verfügung stehen. Je nach Zugang zu den Lademöglichkeiten wird zwischen öffentlicher, halböffentlicher und privater Ladeinfrastruktur unterschieden.
Zur öffentlichen LI zählen Ladepunkte im öffentlich bewirtschafteten Straßenland oder in für Nutzergruppen beschränkten Bereichen (Parkplätze für Lieferanten, Polizei, Feuerwehr…). Hierzu zählen auch Ladepunkte, die nicht rund um die Uhr, sondern mindestens zwölf Stunden Werktags (Montag-Samstag) zur Verfügung stehen.
Zur halböffentlichen LIzählen Ladepunkte, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, dabei aber auf privatem Gelände stehen. Das sind beispielsweise Ladepunkte in Parkgaragen, Hotels und Supermärkten.
Die private LI umfasst Ladepunkte an privaten Stellplätzen (Carport, Garage…).